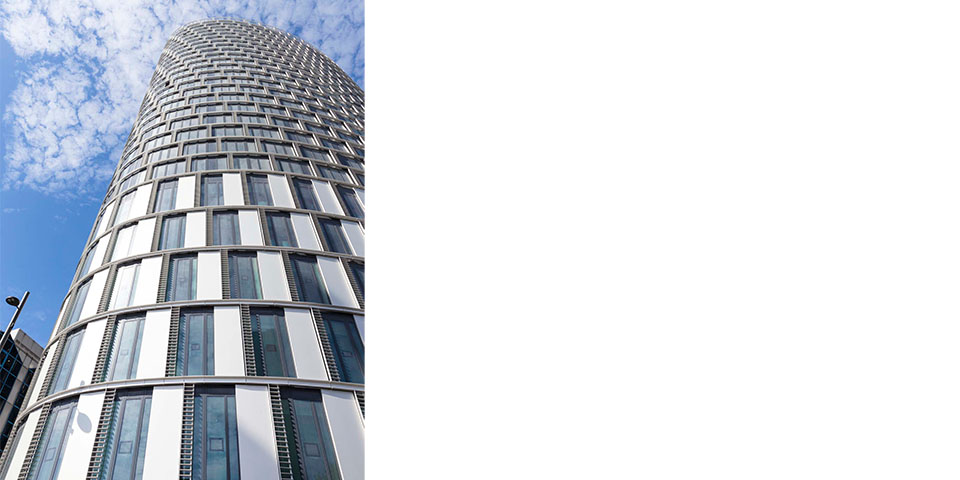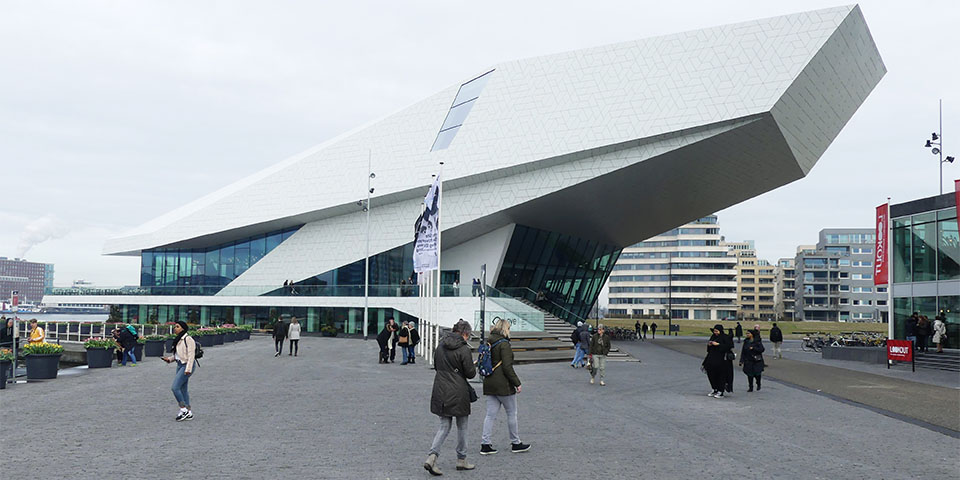Nachhaltigkeit, Umwelt, Arbeitssicherheit und Kreislaufwirtschaft
Die Durchgängigkeit in der Oberflächentechnik
Nachhaltigkeit, Umwelt, Arbeitssicherheit und Kreislaufwirtschaft sind Begriffe, die oft getrennt voneinander betrachtet werden. In der Welt der Oberflächentechnik, in der mit "gefährlichen" Stoffen umgegangen wird, ist dies keine Option, so Egbert Stremmelaar, Direktor der Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION Association). "Aber es passiert, in Den Haag, in Brüssel, ..., ganz zu schweigen von der Anzahl der NGOs, die alle nur einen Schwerpunkt haben. Das Problem ist, dass die Gesellschaft nicht so einfach ist."
Obwohl der Begriff "gefährliche" Stoffe weit verbreitet ist, ist er nach Ansicht von ION nicht korrekt. "Es gibt Stoffe, die bei unsachgemäßer Verwendung (schwere) Gesundheitsschäden verursachen. Die Gefahr liegt also vor allem darin, wie man mit ihnen umgeht. Der Begriff ZZS (besonders besorgniserregende Stoffe) passt daher besser", argumentiert Stremmelaar. "Die große Mehrheit der ZZS-Stoffe sind Produktionsstoffe und kommen im Endprodukt nicht (frei) vor."
Schwimmen
Stremmelaar beginnt seine Vision mit einem Beispiel. "Wasser haben wir in den Niederlanden in Hülle und Fülle. Wenn man zu lange unter Wasser bleibt oder zu viel davon trinkt, besteht die Gefahr des Erstickens oder der Vergiftung. Deshalb haben wir alle gemeinsam alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um richtig mit Wasser umzugehen. Wir bringen den Kindern von klein auf das Schwimmen bei, es gibt eine Überwachung an gefährlichen Stellen, und wenn doch einmal etwas schief geht, gibt es immer ein Rettungsteam. Das gleiche System gilt für die Arbeit mit gefährlichen Stoffen. So arbeiten in einem Betrieb nur Personen, die für den Umgang mit diesen Stoffen geschult sind, nach genau definierten Verfahren und kontrollierten Prozessen. Und auch hier gilt: Sollte unerwartet etwas schief gehen, gibt es einen guten Evakuierungsplan und die Feuerwehr und die Sicherheitsregion als Rückhalt."
Chrom-6
"Die Barrieren der Oosterschelde und des Maaslandes schützen uns vor dem eindringenden Wasser", so Stremmelaar weiter. "Wenn man die Kolbenstangen nicht mit Chrom-6 behandeln würde, würden sie innerhalb von sechs Monaten rosten. Mit anderen Worten: Wenn man Chrom-6 eliminiert, führt man andere Gefahren ein. Setzt man es hingegen in einer geeigneten Anlage ein und verarbeitet es ordnungsgemäß, muss es keine Gesundheitsgefahr darstellen, und man erzielt ein nachhaltiges, sicheres und potenziell rundes Endergebnis. Für das Protokoll: Chromtrioxid (Chrom-6) ist der Herstellungsstoff in der Anlage. Das Endprodukt enthält metallisches Chrom, ähnlich wie der Wasserhahn im Badezimmer. Die Botschaft muss aus allen Blickwinkeln erzählt werden, und das ist das größte Problem. Selbst in Den Haag sind diese Themen getrennt. Das Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft betrachtet die Dinge aus der Umweltperspektive, das Ministerium für Soziales und Beschäftigung konzentriert sich auf Sicherheit und Arbeitshygiene, während das Wirtschaftsministerium aus der wirtschaftlichen Perspektive handelt. Sie sind alle Inseln; jede macht ihr Ding. Das sieht man jetzt bei der Korona-Krise: Es wird nur noch über Gesundheit gesprochen."
Emotionen
Nach Ansicht von Stremmelaar sind viel zu viele Emotionen im Spiel, insbesondere in der Welt der Oberflächenbehandlung. "Damit haben wir zu kämpfen. Wenn man hingegen objektiv an einen Stoff wie Chrom-6 herangeht, könnte man ganz andere Schlussfolgerungen ziehen. Natürlich ist Chrom-6 gesundheitsschädlich, aber wir können diese Risiken beherrschen, indem wir es in geeigneten Anlagen, nach festgelegten Verfahren und in einer kontrollierten Umgebung verwenden. Dann hat es keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, die mit ihm arbeiten. Bedenken Sie außerdem, dass in den Niederlanden 10.000 Menschen mit Chrom-6 arbeiten und dass dieser Stoff in 200 Prozessen verwendet wird. Sollen wir diese Menschen entlassen? Ein Luftfahrtunternehmen hat in Schiphol-Ost eine Galvanisierungsanlage, mit der beschädigte Flugzeuge innerhalb von zwei Stunden repariert werden können. Würden wir diesen Betrieb schließen, um Chrom-6 zu beseitigen, müssten die Flugzeuge für eine ähnliche Reparatur an einen Ort außerhalb der EU gebracht werden. Das bedeutet, dass ein Flugzeug für drei Tage aus der Rotation genommen und leer auf- und abgeflogen werden müsste. Welche Auswirkungen hat das allein auf die CO2-Emissionen?"
Erneuerbare Energien
Auch das Thema Kreislaufwirtschaft berührt mehrere Facetten, stellt Stremmelaar klar. "Durch das weitreichende Recycling von Aluminium zum Beispiel wird der Grundstoff immer stärker belastet. Schließlich werden Kaffeebecher zusammen mit Aluminiumrahmenprofilen gesammelt. Um letztendlich dennoch ein möglichst nachhaltiges, erneuerbares Fensterrahmenprofil zu erhalten, ist eine 'aggressive' Vorbehandlung vor der Beschichtung ein Muss. Oder man muss alles auf hochwertige Weise sammeln und recyceln. Das bedeutet mehrere Trenn- und/oder Sammelsysteme allein für Aluminium, ganz zu schweigen von den anderen Metallen. Kurz gesagt, nicht wünschenswert und wahrscheinlich nicht machbar. Dabei sind die Lösung und das System einfach vorhanden, wie in allen vorherigen Beispielen. Eine Lösung, die der Wirtschaft so wenig wie möglich schadet, Mensch und Umwelt so wenig wie möglich belastet und das alles bei maximaler Lebensdauer."