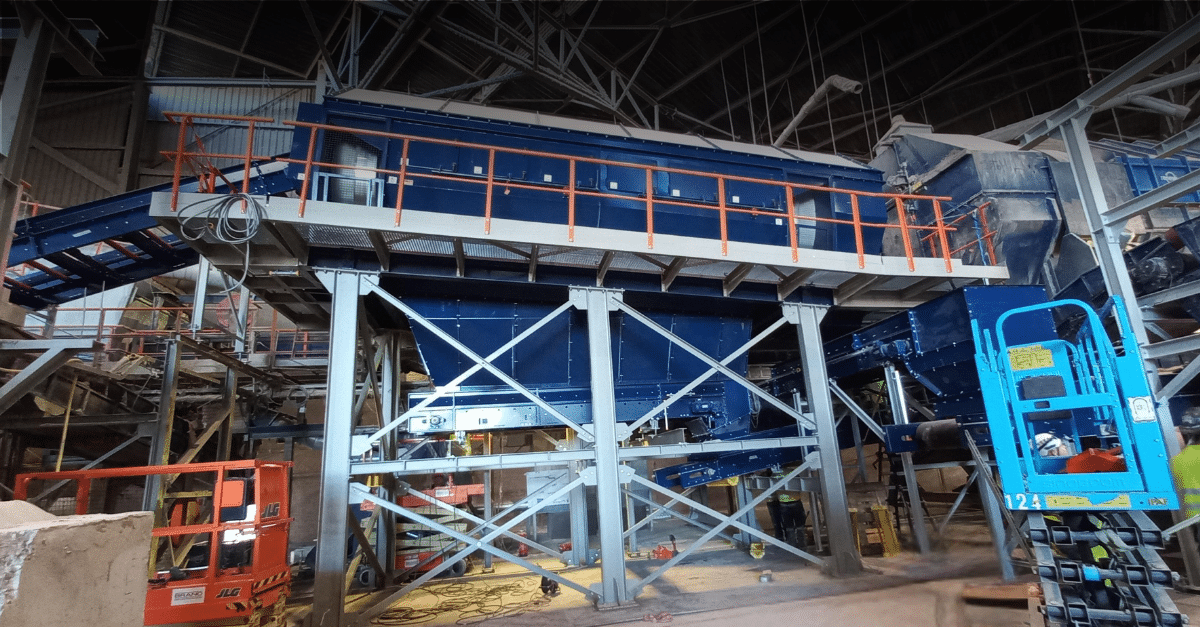Die Gewinner des Betonpreises 2024
Dies sind die führenden Unternehmen im Betonbau
Sechs Projekte haben beim Betonpreis 2024 Preise gewonnen. Jeder dieser Gewinner zeigt, was mit Beton möglich ist: intelligentes, nachhaltiges und innovatives Bauen. Auf den folgenden Seiten können Sie mehr über diese Projekte lesen. Wir haben mit den beteiligten Teams gesprochen und geben einen Blick hinter die Kulissen.
Sechs Kategorien, sechs Gewinner
Die Jury bewertete insgesamt 63 Beiträge. Daraus hat sie 18 Projekte nominiert, die in sechs Kategorien eingeteilt sind. Diese sechs Projekte wurden schließlich mit Preisen ausgezeichnet:
- Nachhaltiges Bauen: Geopolymerbetonbrücke Slaghaam, Rotterdam
- Bestehende Konstruktion: Herta Mohr, Leiden
- Bauwesen: Groote Wielenplas Fahrradbrücke, Rosmalen
- Gehäuse: Jonas, Amsterdam
- Nicht-Wohnungsbau: Besucherzentrum des Niederländischen Amerikanischen Friedhofs, Margraten
- Grenzüberschreitende Konstruktion: Ersatzviadukt Hoog Burel, Apeldoorn
Die Busremise Breda erhielt eine lobende Erwähnung in der Kategorie "Bahnbrechendes Bauwerk". Der Publikumspreis ging an das Netherlands American Cemetery Visitor Center in Margraten.
Was macht diese Projekte so besonders?
Die Preisträger wurden ausgewählt, weil sie alle auf ihre eigene Weise zur Entwicklung des Betonbaus beitragen. Denken Sie an die Anwendung neuer Techniken, die Wiederverwendung bestehender Strukturen oder intelligente Lösungen für komplexe Umgebungen. Die Jury bestand aus neun Experten, unter anderem von der TU Delft, Rijkswaterstaat und verschiedenen Unternehmen des Sektors. Sie bewerteten die Projekte nach den Kriterien Innovation, Qualität, Zusammenarbeit und sozialer Wert.
Eine Tradition seit 1979
Der Concrete Award wird seit 1979 alle zwei Jahre von der Concrete Association verliehen. Er ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der niederländischen Betonbranche. Teilnehmen können nicht nur Projekte in den Niederlanden, sondern auch ausländische Projekte, in die viel niederländisches Betonwissen eingeflossen ist.
Blick in die Zukunft: der Betonpreis 2026
Nach diesem Rückblick blicken wir auch nach vorne. Die Anmeldung für den Concrete Award 2026 wird nächstes Jahr wieder geöffnet. Arbeiten Sie gerade an einem besonderen Projekt? Dann behalten Sie unsere Kommunikation im Auge. Wer weiß, vielleicht stehen Sie 2026 auf dem Siegerpodest!
Kategorie Nachhaltiges Bauen
Geopolymerbetonbrücke Slaghaam: ein Experiment wagen

Rotterdam setzt mit der Geopolymerbetonbrücke Slaghaam in Hoogvliet ein Zeichen für nachhaltiges Bauen. Ein bahnbrechendes Projekt, das innovative Techniken für eine nachhaltigere Zukunft kombiniert. Diese Brücke, die eine veraltete Holzbrücke aus den 1980er Jahren ersetzt, ist ein Beispiel dafür, dass die Stadt keine Angst hat, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das Projekt ist Teil von URBCON, einem Projekt des europäischen Interreg-Programms Nordwesteuropa. "Die Idee dahinter ist, Nebenprodukte aus der Industrie zur Herstellung von neuem Beton zu verwenden", sagt William Schutte, Bauingenieur bei der Stadt Rotterdam. "Die Betonmischung der Brücke in Slaghaam, die auf Geopolymerbeton basiert, bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Beton und reduziert die CO2-Emissionen drastisch. Die Brücke ist nicht nur eine technische Leistung, sondern auch eine Gelegenheit, neue Materialien zu testen und weiterzuentwickeln. Die Verwendung von Geopolymerbeton, der ohne Zement und mit fünfzig Prozent recycelten Zuschlagstoffen hergestellt wird, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufbau."
Laut Schutte war dieser innovative Ansatz jedoch nicht ganz unproblematisch. "Die recycelten Zuschlagstoffe waren zum Beispiel mit Sand, Ton und anderen Stoffen verunreinigt. Dennoch ist es uns gelungen, eine robuste 23 Meter lange Brücke zu bauen, die nicht nur stabil, sondern auch nachhaltig ist. NIBE verglich die Umweltauswirkungen der Geopolymerbetonmischung mit einer herkömmlichen CEM III/B-Betonmischung und kam zu folgendem Ergebnis: Der EQI von herkömmlichem Beton beträgt 23,94 Euro pro m3, der der Mischung in unserer Geopolymerbrücke 17,82 Euro. Und das CO2-Äquivalent pro m3 beträgt 279,86 Kilogramm gegenüber 145,81 Kilogramm. Also eine wesentlich nachhaltigere Lösung."
Rotterdam beweist mit diesem Projekt, dass die Zukunft der Bauindustrie darin liegt, Experimente zu wagen und alternative Materialien einzusetzen. Oder wie Schutte es ausdrückt: "Wenn man nie etwas ausprobiert, wird sich auch nichts ändern". Die Geopolymerbetonbrücke Slaghaam ist ein Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Niederlande, in der kreisförmige und kohlenstoffarme Lösungen zur Norm werden. Rotterdam ist bestrebt, die Arbeit mit nachhaltigem Beton zu intensivieren. Die nächste Brücke wird daher bereits von der Stadtverwaltung vorbereitet. "Wir fordern den Markt heraus, eine innovative Betonmischung vorzuschlagen", sagt er.
Kategorie Bestehende Konstruktion
Herta Mohr: eine Blaupause für nachhaltiges Bauen

Das Herta-Mohr-Gebäude der Universität Leiden wurde renoviert und auf kreisförmige Weise erweitert. Der ursprüngliche Entwurf von Joop van Stigt ist ein Paradebeispiel dafür, wie robust und anpassungsfähig der Betonbau sein kann. Das von einem deutschen Bauunternehmen errichtete 45 Jahre alte Gebäude ruht auf einer hervorragend ausgeführten Betonschale, die aus Pilzsäulen mit einem ausgeklügelten Einfangdetail besteht. Diese Hülle wurde so gut geplant und ausgeführt, dass sie bis heute von außergewöhnlicher Qualität ist.
"Anstatt das Gebäude wegen seiner veralteten Funktionalität abzureißen, haben wir uns für eine gründliche Renovierung unter Beibehaltung der Hülle und eines Teils der Fassaden entschieden", sagt Bart van Kampen vom Architekturbüro De Zwarte Hond, der selbst einmal bei Van Stigt an der TU Delft Unterricht hatte. "Nur der mittlere Teil des Gebäudes wurde entfernt. Bemerkenswerterweise wurden sogar einige Betonsäulen herausgeschnitten und als Fertigteile in einem neuen Gebäudeteil wiederverwendet - ein seltenes, aber wertvolles Beispiel für die hochwertige Wiederverwendung von Ortbeton. Dieser Ansatz sparte eine enorme Menge an CO2 ein und zeigt, dass Beton, auch wenn er derzeit nicht das umweltfreundlichste Material ist, gerade bei langfristiger Verwendung äußerst nachhaltig sein kann."
Führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft
Beton hat eine enorme Eigenfestigkeit und Langlebigkeit, so Van Kampen weiter. "Wenn man Gebäude so konzipiert, dass die Hülle hundert bis hundertfünfzig Jahre hält, kann der Betonbau eine führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft spielen. Vor allem in der Hülle stecken viel Geld und Energie, in der Regel etwa dreißig bis vierzig Prozent eines Gebäudes. Durch eine anpassungsfähige Gestaltung der Gebäudehülle kann ein Gebäude seine Funktion in der Zukunft relativ leicht ändern". Van Kampen zufolge wurde das Projekt durch das S-Schichten-Modell von Stewart Brand inspiriert, bei dem jedem Teil eines Gebäudes eine eigene Lebensdauer zugewiesen wird: Installationen dreißig Jahre, Fassaden siebzig Jahre, Hülle hundertfünfzig Jahre. "Dies lehrt uns, Gebäude mit Blick auf eine künftige Wiederverwendung zu entwerfen - flexibel, anpassungsfähig und für die Zukunft gebaut. So wie das von Herta Mohr: jetzt ein Bildungsgebäude, in dreißig Jahren vielleicht eine Pflegeeinrichtung, in sechzig Jahren ein Hotel und in neunzig Jahren ein Wohnhaus."
Kategorie Bauwesen
Brücke De Groote Wielen: Dauerhafter Beton in perfekter Harmonie
Die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Groote Wielenplas in Rosmalen ist ein wunderbares Beispiel für nachhaltige Architektur. Die Brücke verbindet Ästhetik und Funktionalität, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verwendung von nachhaltigerem GroenR-Beton liegt. Diese Betonmischung, die fünfzehn bis zwanzig Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht als herkömmlicher Beton, ist eine innovative Lösung für eine nachhaltigere Infrastruktur.
GroenR-Beton ist eine zementarme Mischung, die im Rahmen der geltenden Vorschriften verwendet werden kann und ähnliche Eigenschaften wie normaler Beton hat. Bei diesem Projekt wurde es sogar mit wiederverwendetem Schotter aus recyceltem Asphalt kombiniert. Dadurch wird der Einsatz von Primärrohstoffen reduziert und der CO2-Fußabdruck weiter verkleinert. Das Ergebnis ist eine Brücke, die sowohl stabil als auch umweltfreundlich ist und vollständig an Ort und Stelle gegossen wurde. Mit einer Länge von 110 Metern und einer Breite von sieben Metern hat die Brücke ein auffallend schlankes Design. Die Kante der Fahrbahn ist elegant und luftig, und die wellenförmigen Handläufe erinnern an wogendes Schilf und verleihen der Brücke ein natürliches Aussehen. Die Geländer sind modulare Stahlkonstruktionen, die nicht nur ästhetisch sind, sondern auch für künftige Wartungsarbeiten leicht ausgetauscht werden können. Neben Beton wurde auch CLT-Holz (Cross Laminated Timber) für den Lagerbereich des Wassersportvereins verwendet, was der Brücke eine zusätzliche nachhaltige Dimension verleiht. Die Brücke ist außerdem mit einer nachhaltigen Beleuchtung ausgestattet, und der Bau wurde mit elektrischen Geräten durchgeführt, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert.
"Die Gemeinde 's-Hertogenbosch hat dem Entwurfsteam im kreativen Prozess viel Freiheit gelassen, was zu einer Brücke geführt hat, die sowohl optisch als auch technisch hervorragend ist", sagt Jelle Visserman, Regionalmanager bei BAM Infra Netherlands. Er hebt auch die Zusammenarbeit mit A&E Architekten als entscheidend für den Erfolg des Projekts hervor. "Die Fahrradbrücke De Groote Wielen ist ein Beispiel dafür, wie Beton mit den richtigen Modifikationen eine nachhaltige Zukunft unterstützen kann, ohne dass die Qualität oder das Aussehen darunter leiden. Sie ist ein Beispiel dafür, wie die Bauindustrie dazu beitragen kann, unsere Infrastruktur nachhaltiger zu gestalten."
Kategorie Wohnungsbau
Jonas": ein Aushängeschild für eine neue Lebensweise
Jonas' in Amsterdam ist ein Aushängeschild für eine neue Art des Wohnens: bewusst, nachhaltig und auf soziale Interaktion ausgerichtet. ABT lieferte den integralen technischen Entwurf, bei dem Beton eine herausragende Rolle spielte. "Das Design des Bauwerks mit seinen großen Spannweiten, der mäandrierenden Schlucht und den auskragenden Gebäudeköpfen bedeutet, dass dieses Gebäude mit keinem anderen Baumaterial hätte gebaut werden können", sagt Ronald Wenting, Statikberater bei ABT.
ABT kämpfte beim Concrete Award 2024 mit nicht weniger als drei Projekten um den endgültigen Sieg. Mit "Jonas" hat es den Sieg in der Kategorie Wohnungsbau errungen. "Damals war es eine Ausschreibung mit vielen Ambitionen in Bezug auf die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen, und wir haben alle erfüllt. Es ist ein sehr angenehmes Wohngebäude geworden", meint Wenting. "Konstruktiv ist die Hülle wie die Rippenstruktur eines alten Schiffes gestaltet, die sich wie ein Canyon durch das Gebäude schlängelt. Alle Wandscheiben (Rippen) sind Unikate, sehr effizient konstruiert und im unteren Bereich jeweils anders ausgehöhlt. Beton war das einzige Material, das sich dafür eignete. In Holz wären die Formen weniger spektakulär gewesen.
Von BREEAM Outstanding zu Paris Proof
Während der Beton verwendet wurde, um die ehrgeizigen Ziele und die architektonische Gestaltung zu verwirklichen, wurde eine bewusste Entscheidung getroffen, ihn auf eine umweltfreundliche Weise zu verwenden. "Das Haupttragwerk besteht aus Beton mit umweltfreundlichem Zement. Es wurden sekundäre Zuschlagstoffe verwendet und die Menge an Beton und Bewehrungsstahl wurde optimiert. Dadurch konnten die Umweltauswirkungen der Betonteile im Vergleich zu einem herkömmlichen Betonskelett um über 30 Prozent reduziert werden", erläutert Wenting. Dies führte zu einer BREEAM-Zertifizierung mit dem Prädikat hervorragend". "Das gab es vorher noch nicht für ein Wohngebäude", freut sich Wenting und fügt gleich hinzu, dass ABT bereits den nächsten Schritt macht. "Die Entwicklung geht sehr schnell voran. Wir arbeiten jetzt daran, Paris Proof auch mit einer Betonstruktur bauen zu können. Das könnte der nächste Baustein für ein neues Projekt sein."
Kategorie Nichtwohnungsbau
Besucherzentrum des niederländischen amerikanischen Friedhofs - ein unauffälliges Wahrzeichen
In den Vereinigten Staaten hat das Gedenken an Kriege eine lange Tradition. Das ist Teil ihrer Kultur. Gedenkstätten sind daher ernstzunehmende Gebäude, die für die Ewigkeit gemacht sind. Ein gutes Beispiel dafür ist das neue Besucherzentrum auf dem amerikanischen Friedhof in Margraten, das nach einem Entwurf von KAAN Architects im Auftrag der American Battle Monuments Commission errichtet wurde.
Über achttausend Soldaten liegen auf dem amerikanischen Friedhof. "Es gibt immer weniger Überlebende und Angehörige des Zweiten Weltkriegs, die aus erster Hand über diese Zeit berichten können", beginnt Vincent Panhuysen von KAAN Architects. "Deshalb wurde das Besucherzentrum geschaffen, damit wir nicht vergessen. Unsere Aufgabe war es, einen Entwurf zu entwerfen, der nicht in das Friedhofsdenkmal eingreift, aber dennoch eine gewisse Statur hat. Das Ergebnis war ein Entwurf, bei dem wir eine Art viereckigen Kelch kopfüber auf den Rasen stellten. Und indem wir diesen scheinbaren Block 'Stein' um 90 Zentimeter anheben, sieht er aus, als würde er schweben."
Bei dem Kelch handelt es sich um einen dreißig mal dreißig Meter großen und fast vier Meter hohen Fassadenschirm, der rundherum an zwölf Punkten von der Betondachkonstruktion des Kerns des Besucherzentrums herabhängt. Gleichzeitig liegt der Boden des Besucherzentrums neunzig Zentimeter unter dem Erdboden. "Der Weg zum Gebäude fällt langsam ab und führt die Besucher im Uhrzeigersinn durch die Ausstellung über den Krieg und die Geschichte des Friedhofs", erklärt Panhuysen. "Am Ende der Ausstellung blickt man durch den 'Spalt' direkt auf das Friedhofsdenkmal und geht hinaus."
Die Materialisierung des Fassadenscreens wurde sorgfältig ausgewählt. "Sie sollte sich etwas von den Natursteingräbern unterscheiden, aber andererseits nicht zu sehr kontrastieren. Also haben wir uns für Beton entschieden. Der Kelch ist dreihundert Millimeter dick und wird in dreizehn Schichten in einer Schalung ohne Mittelstifte gegossen. Man sieht also keine Nähte, aber man sieht ein gewisses Maß an Schichtung, weil wir für jede Schicht eine etwas andere Betonmischung gewählt haben. Dadurch erhält der ruhige Block einen schönen weichen Ton, der für Naturstein so charakteristisch ist." Auch die Bauweise ist bemerkenswert. "Der Kelch wurde auf dem abgesenkten Erdgeschoss des Besucherzentrums gegossen und dann aufgebockt und an der Dachkonstruktion verankert. Eine wunderbare Arbeit des Bauunternehmers", sagt Panhuysen abschließend.
Kategorie Grenzbau
Ersetzen des Hoog Burel-Viadukts durch wiederverwendete Balken
Der Bau- und Infrastruktursektor konzentriert sich zunehmend auf die Nachhaltigkeit. Die Wiederverwendung von Materialien spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein interessantes Beispiel für diese Entwicklung ist die Wiederverwendung von vorgefertigten Trägern. Dank des industriellen Produktionsprozesses sind sie oft von hoher Qualität und haben eine lange Lebensdauer. Bei der Erneuerung des Hoog Burel-Viadukts über die Autobahn A1 wurden dankenswerterweise vorhandene Träger eines Viadukts in Groningen verwendet.
Die Wiederverwendung von Trägern stammt aus dem SBIR (Strategic Business Innovation Research) Circular Viaducts, einem Forschungsprogramm, mit dem Rijkswaterstaat nützliche Innovationen für Kreisviadukte anregen will. Die Teilnehmer Dura Vermeer, Royal HaskoningDHV, Vlasman und Haitsma Beton wurden nach einer gründlichen Machbarkeitsstudie in der Vorbereitungsphase ausgewählt, um im Jahr 2021 einen Prototyp eines Kreisviadukts zu realisieren. "Mit diesen Unternehmen hatten wir das gesamte Wissen und Know-how an Bord, um gemeinsam den gesamten Zyklus der Sammlung, Bewertung, Gestaltung und Wiederverwendung von Trägern anzugehen", sagt Jasper Schilder von Dura Vermeer.
Das Viadukt Hoog Burel wies Betonschäden auf und war für den Schwerverkehr gesperrt. Eine Erneuerung schien die einzige Option zu sein. "Die Planung für ein neues Viadukt hatte bereits begonnen", weiß Schilder. "Auf traditionelle Weise mit neuen Trägern. Fast gleichzeitig erreichten wir mit dem SBIR das Stadium, in dem wir mit der Suche nach einem geeigneten Bauwerk beginnen konnten. Das Viadukt über die A1 eignete sich perfekt für den Einsatz wiederverwendeter Träger. Zufälligerweise riss Rijkswaterstaat zu dieser Zeit ein Brückendeck in Groningen ab, dessen Träger noch in hervorragendem Zustand waren. So wurde der Entwurf von Hoog Burel mit sechzehn wiederverwendeten Trägern aus Groningen angepasst. Manchmal müssen die Dinge einfach zusammenfallen".
Es war übrigens noch ein gewisser Aufwand nötig, um die Träger auch für die neue Anwendung geeignet zu machen. "Die ursprünglichen Träger waren gerade, während Hoog Burel die A1 in einem Winkel kreuzt. Also wurden die Träger gekürzt und schräg geschnitten. Da die Kräfteverteilung im Brückendeck anders ist als bei den ursprünglich hergestellten Trägern, fügten wir auch zusätzliche Bewehrung hinzu. Es war also alles andere als ein 1:1-Austausch." Das neue Viadukt wurde innerhalb von vier Monaten gebaut und ist ein Musterbeispiel für die Wiederverwendung im Kreislauf.