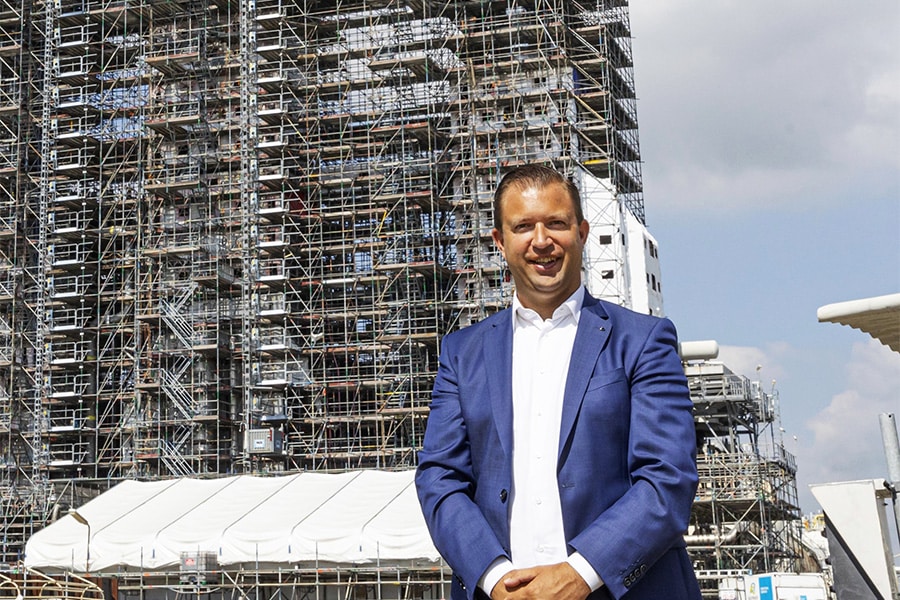Europas größte Wasserstoffanlage läuft mit grüner Energie
In der Dünenlandschaft der Maasvlakte 2 steht der Bau der ersten grünen Wasserstoffanlage Europas kurz vor dem Abschluss. Unter dem Namen Holland Hydrogen 1 (HH1) wird Shell mit Hilfe von Strom aus einem Offshore-Windpark täglich durchschnittlich 60.000 Kilogramm Wasserstoff produzieren und diesen in der Raffinerie Pernis selbst verwenden. Die Raffinerie wird derzeit mit grauem Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen betrieben. Shell unternimmt damit einen wichtigen Schritt, um diese Anlagen nachhaltiger zu gestalten und den CO2-Ausstoß zu verringern. Zu einem späteren Zeitpunkt können auch andere Industrien über eine Pipeline mit grünem Wasserstoff versorgt werden.
In den Niederlanden entfällt etwa die Hälfte des Energieverbrauchs auf die Industrie. Sie verursacht auch ein Viertel der CO2-Emissionen. Das muss gesenkt werden, und eine der Alternativen, die die Industrie zu fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Erdgas hat, ist Wasserstoff. Aus diesem Grund arbeiten die Niederlande an einer Wasserstoffinfrastruktur.

Elektrolyse
Zur Herstellung von Wasserstoff nutzt die Anlage die alkalische Elektrolyse, eine Methode zur Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe von elektrischem Strom. "Dies geschieht in den zehn Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt, die in einer großen Halle auf dem Gelände stehen", sagt Bas van de Werff, Projektleiter Holland Hydrogen 1 bei Shell. "Diese und andere Anlagen auf dem Gelände werden mit Strom aus einem Offshore-Windpark betrieben, den Shell in einem Joint Venture mit Eneco vor der Küste von Egmond aan Zee errichtet hat. Über eine bestehende Kabelverbindung ist dieser Windpark an das 380-kV-Umspannwerk Maasvlakte angeschlossen. Aus diesem grünen Strom und dem Wasser von Evides stellen wir grünen Wasserstoff her."
Keine Fertighäuser
Für das Kerngeschäft von HH1, die Elektrolyse, bauten Visser en Smit Bouw eine große Elektrolyse-Halle aus Beton und Stahl, mit 33 großen Fachwerkbindern und 4.000 m² Dach- und Wandverkleidung. Van de Werf: "Der Boden besteht aus einer dicken Betonplatte, und abgesehen von ein paar Sprengwänden ist alles andere aus Stahl. Die vielen Viadukte, die man auf dem Weg hierher passieren muss, und die Transportbeschränkungen machen es schwierig, mit großen Modulen zu arbeiten. Deshalb wird beim Bau praktisch keine Vorfertigung eingesetzt.

Sprengwände
Nach der Erzeugung in der Elektrolysehalle wird der Wasserstoff auf der Südseite über drei Piperacks zu zwei Kompressoren geleitet, die das Gas auf 50 bar verdichten. "Diese 60-Megawatt-Anlage ist der einzige Teil von HH1 mit einer dynamischen Belastung des Fundaments", erklärt Van de Werff. "Um ein stabiles Fundament zu schaffen, wurde auf dem verdichteten Untergrund vor den Verdichtern ein sechs Meter dicker Boden mit zweitausend Kubikmetern Beton gegossen. Darauf wurden 80 Zentimeter dicke Buchten mit acht bis 10 Meter hohen Sprengwänden gebaut. Ein Leck in einem Kompressor kann in Ausnahmefällen eine Explosion auslösen; unsere Nachbarn sollen davon nicht betroffen sein. Alle anderen Gebäude und Anlagen sind auf Pfählen gegründet. Das zurückgewonnene Land bietet extrem stabile Bodenverhältnisse.
Armdickes Kabel
An der Nordseite der Elektrolysehalle steht eine beeindruckende 850 Tonnen schwere Stahlkonstruktion. "Das ist der Aufbau für die Luftkühler", erklärt Van de Werff. "Sie sorgen dafür, dass wir die bei der Elektrolyse freigesetzte Restwärme abführen können. Idealerweise würden wir diese Restwärme gerne im Hafen wiederverwenden, aber dafür gibt es hier noch keine Infrastruktur. Vielleicht wäre es wirtschaftlich sinnvoll, wenn sich Wärmeabnehmer auf den angrenzenden Grundstücken ansiedeln oder ein Anschluss an das Fernwärmenetz hergestellt werden könnte. An der Ostseite der Elektrolysehalle befinden sich die wichtigsten Elektroinstallationen. Das armdicke 380-kV-Kabel verschwindet hier im Umspannwerk, wo die Leistung auf 33 kV reduziert wird. Fünf Transformatoren gegenüber dem Elektrolysegebäude wandeln diese Spannung wieder in 670 V Gleichstrom um. All dies erfordert eine Menge schwerer Kabel, die in Durchlässen verlegt werden. Man möchte, dass die Leitungen von Anfang an richtig verlegt werden, damit man sie später nicht umverlegen muss."
Skandinavisches Hauptgebäude
Auf dem kompakten, gut gefüllten Gelände befinden sich auch eine Sauerstoffbelüftungsleitung, eine Notbelüftungsleitung für Wasserstoff, eine Messstation, ein kleines Gebäude für die Wasseraufbereitung und ein Nebengebäude mit Servern. "Ganz zu schweigen vom Hauptgebäude mit allen Steuerungssystemen", fügt Van de Werff hinzu. "Das steht am Kreisverkehr außerhalb des Werksgeländes. Das Schöne daran ist, dass wir hier auf dem Betonsockel mit allen Installationen für die Steuerungssysteme einen Aufbau realisieren, der vollständig aus recycelten Materialien besteht. Für eine industrielle Anwendung halte ich das für etwas ganz Besonderes. Das Beispiel war eine Grundschule, die von Visser & Smit Bouw im Zentrum von Rotterdam gebaut wurde. Gemeinsam mit dem Holzspezialisten De Groot Vroomshoop bauen wir hier ein repräsentatives Hauptgebäude, das durch das verwendete Holz ein skandinavisches Flair vermitteln soll. Natürlich passt es auch wunderbar in die Dünenlandschaft der Maasvlakte. Der runde Zaun, der auf der Zeichnung noch als geschlossene Sandbarriere eingezeichnet war, wird wohl ein offener Zaun werden. "
"Zunächst wird der Wasserstoff seinen Weg zu unserer Raffinerie und unserem Chemiewerk in Pernis finden", schließt Van de Werff. "Wir wollen das so bald wie möglich auf andere Industriekunden ausweiten. Sobald mehr Lkw mit Wasserstoff betrieben werden, könnten wir sie auch mit grünem Wasserstoff versorgen. Mit dieser Investition übernimmt Shell eine Vorreiterrolle bei der Erzeugung erneuerbarer Energien".
Informationen zur Konstruktion
- Kunde Shell
- Technik Worley
- Auftragnehmer Visser & Smit Konstruktion
- Stahlbau De Kok Stahlkonstruktion